Ikarus, Satyr, Nixe Das Skulpturen-Trio am Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) in Eschborn Wolfgang Hätscher-Rosenbauer
Die Entstehung der Skulpturen

„Man suche nichts hinter den Dingen.
Ein Ding recht beschaut, offenbart sein Wesentliches“
J.W. v.Goethe
"Ikarus"
portugiesischer Marmor, ca 140x85x60 cm Der Stein lag, wahrscheinlich schon zur Zeit der Entstehung der Ikarus-Legende, im portugiesischen Meer. Das Wasser des Meeres hat den Stein über Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende geformt, charakteristisch ausgehöhlt und zum Teil durchspült. Ich folgte beim Bearbeiten des Steines zunächst nur den vorgegebenen Linienführungen und Flächen. Im Verlauf des Verstärkens und Glättens der am Stein durch das Wasser vorgeprägten Formen schälte sich für mich eine liegende Gestalt heraus. Das Bild des auferstehenden – nicht des sterbenden- Ikarus kam mir in den Sinn. Danach war es einfach, die Formgebung zu vollenden. (Michelangelo sagte einmal, er nehme beim Stein nur das weg, was nicht zur Skulptur dazugehöre). Für mich hat dieser Ikarus durch das Meer und im Stein eine Wandlung erfahren. Der Ikarus der Antike ist der jugendliche, unreife, in gewisser Weise unbewusste Mensch (Mann), der auf die fortgeschrittenste Technik seiner Zeit -künstliche Flügel- zurückgreifen konnte, die ihm die Gesellschaft (in Gestalt seines Vaters Daedalus) zur Verfügung stellte, um damit seine Freiheit zu erreichen; und der damit – aus Überschwang, aus Übermut, Grenzen überschreitet: Er kommt dem Feuer, der Sonne, zu nahe, das Wachs, mit dem die Federn seiner Flügel befestigt sind, schmilzt, er stürzt ins Wasser, ertrinkt. Der Ikarus, den das Meer im Stein wieder freigibt, ist der geläuterte, der gereifte, der bewusstere Ikarus, der, immer noch und mehr denn je vom Willen zur Freiheit beseelt, seine Grenzen und Möglichkeiten erforschen will, der aber mit mehr Achtung, vielleicht auch Demut den Kräften der Natur begegnet . Er ist einer, der darauf achten wird, ob die technischen, elektronischen und sonstigen Hilfsmittel, die er vorfindet (selbst wenn sie von seinem eigenen Vater stammen), ihn und andere nicht gefährden. Er will mit ihrer Hilfe in Einklang mit den Kräften der Natur bleiben, weiter auf der Suche nach Freiheit. Er ist, wenn ich ihn so anschaue, der auferstehende, aufstrebende Ikarus, berstend vor Energie und Tatendrang, bereit, sich in ein neues Abenteuer, das Abenteuer des Lebens, zu stürzen. Das Wasser wird für ihn immer ein Element der Klärung und Läuterung sein. Er wird Mitverantwortung dafür übernehmen, alles Menschenmögliche zu tun, damit es seine natürliche Klarheit und Energie behält – oder dass diese wiederhergestellt wird.

"Satyr'"
Italienischer Marmor, Carrara Die Skulptur entstand aus dem größeren Teil eines Blockes Cararra-Marmor, der zu schwer für den Transport war und daher geteilt wurde. Allein der Prozess des Teilens ist eine spannende und sinnliche Erfahrung: Es werden Löcher ringsum gebohrt, in die Rundkeile gesetzt werden. Diese werden mit Hammerschlägen immer tiefer in den Stein getrieben, wobei die dabei erzeugten Schwingungen immer höhere Spannungen im Stein erzeugen, die als Töne hörbar werden. Am Ende geht, mit einem leichten Hammerschlag, ein Riss durch den Block, und der Stein teilt sich. Die Arbeit am Stein erfolgte wiederum fast ausschließlich mit Hammer und Meißel, über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren hin, in der „Offenen Werkstatt“ von Joachim Kreutz in Frankfurt-Niederursel, am Rande der Großstadt, umgeben von Pferdeweiden. Es gab Zeiten, an denen ich nur ein- bis zweimal wöchentlich am Stein arbeiten konnte, dann auch wieder wochenlang nicht, zu manchen Zeiten aber auch einige Tage hintereinander am Stück. Dem Stein und mir selbst taten die Pausen gut. Ohne Zeit- und Ergebnisdruck künstlerisch tätig sein zu können, ist ein Privileg, das ich sehr schätze und nicht missen möchte. Die Idee eines Satyrkopfes entstand relativ früh, da der Stein durch seine Beschaffenheit mir ein Muster anbot, dem ich folgen konnte. Dass er zwei sehr unterschiedliche Seiten zeigen würde, wurde mir erst relativ spät klar. Ich liebe die Spannung zwischen Gegensätzen, und von daher war es eine großartige Herausforderung, von beiden Seiten her auf das Gesicht mit Nase, Mund und Augen hinzuarbeiten, das die beiden unterschiedlichen Ausdrücke- eine Seite mit mehr menschlichen Zügen, eine mit mehr tierischen – vereinigen musste. Der Satyr, halb Mensch, halb Tier. In der griechischen Mythologie Symbol der Ausgelassenheit und Sinnlichkeit des Lebens. Animalische Triebkräfte stehen im Gegensatz- und verbinden sich- mit humanen Gesichtszügen. Diese Spannung durchdringt den Stein vollständig. Es gibt keine Symmetrie. Jede Ansicht offenbart neue Gegensätze und neue Verbindungen. Der Ausdruck bleibt durch und durch ambigue. Die Züge drücken je nach Blickwinkel mildes Staunen oder grimmige Entschlossenheit aus. Der Hals ist nur grob behauen und wirkt wie ein Fels, aus dem der Kopf herauswächst. 
„Nixe“
Italienischer Marmor, Carrara
Die „Nixe“ ist aus demselben (geteilten) Block Marmor entstanden, wie der „Satyr“. Dieser Stein erlebte eine erstaunliche Umwandlung. Nach dem ersten „Schälen“ des Steins – das ist die Entfernung der äußeren, schon etwas durch die Lagerung verwitterten Schicht, bei der sehr viel erfahrbar wird über die Beschaffenheit , Qualität und Eigenschaften des Steins, auch eventuelle Mängel- war die „Erste Idee“ (die oft, aber nicht immer die entscheidende ist), dass darin ein Vogel – ein Adler- angelegt sein könnte. Doch als ich den vermeintlichen Adlerkopf herauszuarbeiten begann, hatte der Stein just an dieser Stelle einen feinen Riss, so dass er dort brach, wo der Schnabel hätte sein müssen. Mit solchen Enttäuschungen muss man als Bildhauer lernen zu leben. Was weg ist, ist weg. Der Stein wollte also kein Vogel werden. (Das Vogelthema war dann einem anderen, späteren Stein vorbehalten, und wurde als „Sonnenvogel“ 2014 vollendet.) Ich liess also wieder alle inneren Bilder los (nicht ganz freiwillig) und begann von Neuem, den Stein zu erkunden und mit Klöpfel und Meißel von allen Seiten „zu befragen“. Er „antwortete“ mit einem zarten weiblichen Gesicht an der Stelle, an der Adlerkopf (nun ohne Schnabel) hätte sein sollen. Als ich es herausarbeitete, folgte eine wallende Haarpracht, ein mädchenhaft kleiner Busen und ein massiger Unterleib – und wieder hatte ich ein Zwitterwesen vor mir. Aber ein Fischschwanz war in dem noch kompakten, massigen Block, aus dem der Unterleib bestand, noch nicht sichtbar. Wieder war eine längere Pause notwendig, bis in einer plötzlichen Eingebung das Bild einer kleinen Nixe, die auf ihrem massigen Fischschwanz wie auf einem Hocker sitzt, kam. Die Vorstellung, wie der Schwanz dann von allen Seiten stimmig auszusehen hat, war dann eine größere Herausforderung. Ganz zum Schluss, im Wellenmuster am Fuß der Nixe, blickte mich im Stein das Gesicht eines Jünglings an, das noch herausgearbeitet werden wollte. Da kannte ich noch nicht die Ballade „Der Fischer“ von Goethe, und auch nicht das Märchen der Gebrüder Grimm („Nixe am Teich“) für die diese Nixe ein Sinnbild sein kann.
Goethe: Der Fischer Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
Ein Fischer saß daran,
Sah nach dem Angel ruhevoll,
Kühl bis ans Herz hinan.
Und wie er sitzt und wie er lauscht,
Teilt sich die Flut empor:
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib hervor.
Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:
»Was lockst du meine Brut
Mit Menschenwitz und Menschenlist
Hinauf in Todesglut?
Ach wüßtest du, wie's Fischlein ist
So wohlig auf dem Grund,
Du stiegst herunter, wie du bist,
Und würdest erst gesund.
Labt sich die liebe Sonne nicht,
Der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenatmend ihr Gesicht
Nicht doppelt schöner her?
Lockt dich der tiefe Himmel nicht,
Das feuchtverklärte Blau?
Lockt dich dein eigen Angesicht
Nicht her in ew'gen Tau?«
Das Wasser rauscht', das Wasser schwoll,
Netzt' ihm den nackten Fuß;
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll
Wie bei der Liebsten Gruß.
Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm;
Da war's um ihn geschehn;
Halb zog sie ihn, halb sank er hin
Und ward nicht mehr gesehn.
Gebrüder Grimm: Die Nixe im Teich.
Es war einmal ein Müller, der führte mit seiner Frau ein vergnügtes Leben. Sie hatten Geld und Gut, und ihr Wohlstand nahm von Jahr zu Jahr noch zu. Aber Unglück kommt über Nacht: wie ihr Reichthum gewachsen war, so schwand er von Jahr zu Jahr wieder hin, und zuletzt konnte der Müller kaum noch die Mühle, in der er saß, sein Eigenthum nennen. Er war voll Kummer, und wenn er sich nach der Arbeit des Tags nieder legte, so fand er keine Ruhe, sondern wälzte sich voll Sorgen in seinem Bett. Eines Morgens stand er schon vor Tagesanbruch auf, gieng hinaus ins Freie und dachte es sollte ihm leichter ums Herz werden. Als er über dem Mühldamm dahin schritt, brach eben der erste Sonnenstrahl hervor, und er hörte in dem Weiher etwas rauschen. Er wendete sich um und erblickte ein schönes Weib, das sich langsam aus dem Wasser erhob. Ihre langen Haare, die sie über den Schultern mit ihren zarten Händen gefaßt hatte, flossen an beiden Seiten herab und bedeckten ihren weißen Leib. Er sah wohl daß es die Nixe des Teichs war und wußte vor Furcht nicht ob er davon gehen oder stehen bleiben sollte. Aber die Nixe ließ ihre sanfte Stimme hören, nannte ihn bei Namen und fragte warum er so traurig wäre. Der Müller war anfangs verstummt, als er sie aber so freundlich sprechen hörte, faßte er sich ein Herz und erzählte ihr daß er sonst in Glück und Reichthum gelebt hätte, aber jetzt so arm wäre, daß er sich nicht zu rathen wüßte. „Sei ruhig,“ antwortete die Nixe, „ich will dich reicher und glücklicher machen als du je gewesen bist, nur mußt du mir versprechen daß du mir geben willst was eben in deinem Hause jung geworden ist.“ „Was kann das anders sein,“ dachte der Müller, „als ein junger Hund oder ein junges Kätzchen?“ und sagte ihr zu was sie verlangte. Die Nixe stieg wieder in das Wasser hinab, und er eilte getröstet und gutes Muthes nach seiner Mühle. Noch hatte er sie nicht erreicht, da trat die Magd aus der Hausthüre und rief ihm zu er sollte sich freuen, seine Frau hätte ihm einen kleinen Knaben geboren. Der Müller stand wie vom Blitz gerührt, er sah wohl daß die tückische Nixe das gewußt und ihn betrogen hatte. Mit gesenktem Haupt trat er zu dem Bett seiner Frau, und als sie ihn fragte „warum freust du dich nicht über den schönen Knaben?“ so erzählte er ihr was ihm begegnet war und was für ein Versprechen er der Nixe gegeben hatte. „Was hilft mir Glück und Reichthum,“ fügte er hinzu, „wenn ich mein Kind verlieren soll? aber was kann ich thun?“ Auch die Verwandten, die herbeigekommen waren, Glück zu wünschen, wußten keinen Rath. Indessen kehrte das Glück in das Haus des Müllers wieder ein. Was er unternahm gelang, es war als ob Kisten und Kasten von selbst sich füllten und das Geld im Schrank über Nacht sich mehrte. Es dauerte nicht lange, so war sein Reichthum größer als je zuvor. Aber er konnte sich nicht ungestört darüber freuen: die Zusage, die er der Nixe gethan hatte, quälte sein Herz. So oft er an dem Teich vorbei kam, fürchtete er sie möchte auftauchen und ihn an seine Schuld mahnen. Den Knaben selbst ließ er nicht in die Nähe des Wassers: „hüte dich,“ sagte er zu ihm, „wenn du das Wasser berührst, so kommt eine Hand heraus, hascht dich und zieht dich hinab.“ Doch als Jahr auf Jahr vergieng, und die Nixe sich nicht wieder zeigte, so fieng der Müller an sich zu beruhigen. Der Knabe wuchs zum Jüngling heran und kam bei einem Jäger in die Lehre. Als er ausgelernt hatte und ein tüchtiger Jäger geworden war, nahm ihn der Herr des Dorfes in seine Dienste. In dem Dorf war ein schönes und treues Mädchen, das gefiel dem Jäger, und als sein Herr das bemerkte, schenkte er ihm ein kleines Haus; die beiden hielten Hochzeit, lebten ruhig und glücklich und liebten sich von Herzen. Einsmals verfolgte der Jäger ein Reh. Als das Thier aus dem Wald in das freie Feld ausbog, setzte er ihm nach und streckte es endlich mit einem Schuß nieder. Er bemerkte nicht daß er sich in der Nähe des gefährlichen Weihers befand, und gieng, nachdem er das Thier ausgeweidet hatte, zu dem Wasser, um seine mit Blut befleckten Hände zu waschen. Kaum aber hatte er sie hinein getaucht, als die Nixe emporstieg, lachend mit ihren nassen Armen ihn umschlang und so schnell hinabzog, daß die Wellen über ihm zusammenschlugen. Als es Abend war und der Jäger nicht nach Haus kam, so gerieth seine Frau in Angst. Sie gieng aus ihn zu suchen, und da er ihr oft erzählt hatte daß er sich vor den Nachstellungen der Nixe in Acht nehmen müßte und nicht in die Nähe des Weihers sich wagen dürfte, so ahnte sie schon was geschehen war. Sie eilte zu dem Wasser, und als sie am Ufer seine Jägertasche liegen fand, da konnte sie nicht länger an dem Unglück zweifeln. Wehklagend und händeringend rief sie ihren Liebsten mit Namen, aber vergeblich: sie eilte hinüber auf die andere Seite des Weihers, und rief ihn aufs neue: sie schalt die Nixe mit harten Worten, aber keine Antwort erfolgte. Der Spiegel des Wassers blieb ruhig, nur das halbe Gesicht des Mondes blickte unbeweglich zu ihr herauf. Die arme Frau verließ den Teich nicht. Mit schnellen Schritten, ohne Rast und Ruhe, umkreißte sie ihn immer von neuem, manchmal still, manchmal einen heftigen Schrei ausstoßend, manchmal in leisem Wimmern. Endlich waren ihre Kräfte zu Ende: sie sank zur Erde nieder und verfiel in einen tiefen Schlaf. Bald überkam sie ein Traum. Sie stieg zwischen großen Felsblöcken angstvoll aufwärts; Dornen und Ranken hakten sich an ihre Füße, der Regen schlug ihr ins Gesicht und der Wind zauste ihr langes Haar. Als sie die Anhöhe erreicht hatte, bot sich ein ganz anderer Anblick dar. Der Himmel war blau, die Luft mild, der Boden senkte sich sanft hinab und auf einer grünen, bunt beblümten Wiese stand eine reinliche Hütte. Sie gieng darauf zu und öffnete die Thüre, da saß eine Alte mit weißen Haaren, die ihr freundlich winkte. In dem Augenblick erwachte die arme Frau. Der Tag war schon angebrochen, und sie entschloß sich gleich dem Traum Folge zu leisten. Sie stieg mühsam den Berg hinauf, und es war alles so, wie sie es in der Nacht gesehen hatte. Die Alte empfieng sie freundlich und zeigte ihr einen Stuhl, auf den sie sich setzen sollte. „Du mußt ein Unglück erlebt haben,“ sagte sie, „weil du meine einsame Hütte aufsuchst.“ Die Frau erzählte ihr unter Thränen was ihr begegnet war. „Tröste dich,“ sagte die Alte, „ich will dir helfen: da hast du einen goldenen Kamm. Harre bis der Vollmond aufgestiegen ist, dann geh zu dem Weiher, setze dich am Rand nieder und strähle dein langes schwarzes Haar mit diesem Kamm. Wenn du aber fertig bist, so lege ihn am Ufer nieder, und du wirst sehen was geschieht.“ Die Frau kehrte zurück, aber die Zeit bis zum Vollmond verstrich ihr langsam. Endlich erschien die leuchtende Scheibe am Himmel, da gieng sie hinaus an den Weiher, setzte sich nieder und kämmte ihre langen schwarzen Haare mit dem goldenen Kamm, und als sie fertig war, legte sie ihn an den Rand des Wassers nieder. Nicht lange, so brauste es aus der Tiefe, eine Welle erhob sich, rollte an das Ufer und führte den Kamm mit sich fort. Es dauerte nicht länger als der Kamm nöthig hatte, auf den Grund zu sinken,so theilte sich der Wasserspiegel und der Kopf des Jägers stieg in die Höhe. Er sprach nicht, schaute aber seine Frau mit traurigen Blicken an. In demselben Augenblick kam eine zweite Welle herangerauscht und bedeckte das Haupt des Mannes. Alles war verschwunden, der Weiher lag so ruhig wie zuvor und nur das Gesicht des Vollmondes glänzte darauf. Trostlos kehrte die Frau zurück, doch der Traum zeigte ihr die Hütte der Alten. Abermals machte sie sich am nächsten Morgen auf den Weg und klagte der weisen Frau ihr Leid. Die Alte gab ihr eine goldene Flöte, und sprach „harre bis der Vollmond wieder kommt, dann nimm diese Flöte, setze dich an das Ufer, blas ein schönes Lied darauf, und wenn du damit fertig bist, so lege sie auf den Sand; du wirst sehen was geschieht.“ Die Frau that wie die Alte gesagt hatte. Kaum lag die Flöte auf dem Sand, so brauste es aus der Tiefe: eine Welle erhob sich, zog heran, und führte die Flöte mit sich fort. Bald darauf theilte sich das Wasser und nicht bloß der Kopf auch der Mann bis zur Hälfte des Leibes stieg hervor. Er breitete voll Verlangen seine Arme nach ihr aus, aber eine zweite Welle rauschte heran, bedeckte ihn und zog ihn wieder hinab. „Ach, was hilft es mir,“ sagte die Unglückliche, „daß ich meinen Liebsten nur erblicke, um ihn wieder zu verlieren.“ Der Gram erfüllte aufs neue ihr Herz, aber der Traum führte sie zum drittenmal in das Haus der Alten. Sie machte sich auf den Weg, und die weise Frau gab ihr ein goldenes Spinnrad, tröstete sie und sprach „es ist noch nicht alles vollbracht, harre bis der Vollmond kommt, dann nimm das Spinnrad, setze dich an das Ufer und spinn die Spuhle voll, und wenn du fertig bist, so stelle das Spinnrad nahe an das Wasser und du wirst sehen was geschieht.“ Die Frau befolgte alles genau. Sobald der Vollmond sich zeigte, trug sie das goldene Spinnrad an das Ufer und spann emsig bis der Flachs zu Ende und die Spuhle mit dem Faden ganz angefüllt war. Kaum aber stand das Rad am Ufer, so brauste es noch heftiger als sonst in der Tiefe des Wassers, eine mächtige Welle eilte herbei und trug das Rad mit sich fort. Alsbald stieg mit einem Wasserstrahl der Kopf und der ganze Leib des Mannes in die Höhe. Schnell sprang er ans Ufer, faßte seine Frau an der Hand und entfloh. Aber kaum hatten sie sich eine kleine Strecke entfernt, so erhob sich mit entsetzlichem Brausen der ganze Weiher und strömte mit reißender Gewalt in das weite Feld hinein. Schon sahen die Fliehenden ihren Tod vor Augen, da rief die Frau in ihrer Angst die Hilfe der Alten an, und in dem Augenblick waren sie verwandelt, sie in eine Kröte, er in einen Frosch. Die Flut, die sie erreicht hatte, konnte sie nicht tödten, aber sie riß sie beide von einander und führte sie weit weg. Als das Wasser sich verlaufen hatte und beide wieder den trocknen Boden berührten, so kam ihre menschliche Gestalt zurück. Aber keiner wußte wo das andere geblieben war; sie befanden sich unter fremden Menschen, die ihre Heimat nicht kannten. Hohe Berge und tiefe Thäler lagen zwischen ihnen. Um sich das Leben zu erhalten mußten beide die Schafe hüten. Sie trieben lange Jahre ihre Herden durch Feld und Wald und waren voll Trauer und Sehnsucht. Als wieder einmal der Frühling aus der Erde hervorgebrochen war, zogen beide an einem Tag mit ihren Herden aus und der Zufall wollte daß sie einander entgegen zogen. Er erblickte an einem fernen Bergesabhang eine Herde und trieb seine Schafe nach der Gegend hin. Sie kamen in einem Thal zusammen, aber sie erkannten sich nicht, doch freuten sie sich daß sie nicht mehr so einsam waren. Von nun an trieben sie jeden Tag ihre Herde neben einander: sie sprachen nicht viel, aber sie fühlten sich getröstet. Eines Abends, als der Vollmond am Himmel schien und die Schafe schon ruhten, holte der Schäfer die Flöte aus seiner Tasche und blies ein schönes aber trauriges Lied. Als er fertig war, bemerkte er daß die Schäferin bitterlich weinte. „Warum weinst du?“ fragte er. „Ach,“ antwortete sie, „so schien auch der Vollmond als ich zum letztenmal dieses Lied auf der Flöte blies und das Haupt meines Liebsten aus dem Wasser hervorkam.“ Er sah sie an und es war ihm als fiele eine Decke von den Augen, er erkannte seine liebste Frau: und als sie ihn anschaute und der Mond auf sein Gesicht schien, erkannte sie ihn auch. Sie umarmten und küßten sich, und ob sie glückselig waren braucht keiner zu fragen.
|
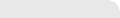
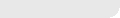














 Print
Print